
Inflation: Staatsfeind Nr. 1 oder Liebling der Schuldenpolitik?
Publiziert am 25.04.2022 MESZ
Bis vor kurzem war sie ein (fast) vergessenes Gespenst aus der Vergangenheit. Heute jagt eine Inflationsschlagzeile die nächste – nicht nur in Wirtschaftszeitungen. In diesem Grundlagenartikel nehmen drei Ökonomen dem Gespenst seinen Schrecken.
Erfahren Sie, was Inflation überhaupt ist, wie sie entsteht und welches die häufigsten Arten der Inflation sind.
Inflation als Spielball der Politik
Der russische Revolutionär Wladimir Lenin hielt sie für ein gutes Mittel zur «Zerschlagung der Bourgeoisie». Gerald Ford, der 38. Präsident der Vereinigten Staaten, erklärte sie zum «Staatsfeind Nummer eins». Nach ihm beschrieb sie Ronald Reagan als «gewalttätig wie ein Strassenräuber, furchterregend wie ein bewaffneter Räuber und tödlich wie ein Auftragsmörder».
Um die Inflation begreifbar zu machen, behelfen sich sogar gestandene Staatsmänner mit Metaphern, wie sie für bewaffnete Konflikte verwendet werden. Woher kommt diese reflexartige Inflationsangst, die vielen in den Knochen steckt?
Wenn die gute alte Ökonomie die Aufmerksamkeit von Wirtschaft und Politik, von links bis rechts und rund um den Globus auf sich zieht, dann lohnt es sich, das Schreckgespenst mit nüchternen Fakten zu durchleuchten.
KURZ ERKLÄRT
Definition: Was ist Inflation?
Der Begriff «Inflation» beschreibt einen allgemeinen Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft. Dieser «allgemeine Anstieg» für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen ist wichtig – Inflation entsteht nicht dadurch, dass ein einzelner Gegenstand teurer wird, sondern nur dann, wenn es zu einem Preisanstieg auf breiter Basis kommt. Im Laufe der Zeit schmälert dieser Preisanstieg die Kaufkraft einer bestimmten Währung in einer Volkswirtschaft.
Importierte Inflation
Inflation kann nicht nur Auswirkungen auf die heimische Währung eines Landes haben. Sie beeinflusst unter Umständen auch den Wechselkurs des Landes gegenüber anderen Ländern und hat damit Folgen für den Handel mit Waren und Dienstleistungen. Denn je mehr die Währung eines Landes auf dem Devisenmarkt an Wert verliert, desto höher ist der Preis, den das Land für Importe zahlen muss. Das wirkt sich im Fall von Rohstoffen oder Energie auch auf die inländischen Produktionskosten eines Landes aus.
Wie kommt es zu einer Inflation?
Dass die Preise 2021 anziehen würden, kam für die meisten Analysten wenig überraschend. Aufgrund sogenannter Basiseffekte, Angebots-Nachfrage-Engpässen und des starken wirtschaftlichen Aufschwungs nach den Lockdowns war es nur eine Frage der Zeit, bis sich ein gewisses Mass an Inflation bemerkbar machen würde.
Die Ursachen für eine Inflation führen wir auf den Zeithorizont ihres Einflusses zurück. In unseren Analysen unterscheiden wir daher kurz-, mittel- und langfristige Faktoren.
Drei Faktoren, die Preise in die Höhe treiben können
Wir betrachten Inflation als «kurzfristig», wenn sie einen Zeitraum von einem Jahr nicht überdauert.
Ein wichtiger kurzfristiger Faktor sind zum Beispiel Lieferengpässe, wie sie die Pandemie ausgelöst hat. Vor allem die Automobilhersteller können ein Lied davon singen: Viele von ihnen hatten Schwierigkeiten, an Halbleiterchips und andere Fahrzeugkomponenten zu kommen, nachdem verschiedene asiatische Fabriken über Wochen stillgestanden waren.
Abgesehen davon kann auch ein plötzlicher Anstieg der Nachfrage zu höheren Preisen führen. Dies war zum Beispiel bei der Wiedereröffnung der Wirtschaft nach den Lockdowns der Fall.
Andere Faktoren können wetterbedingt sein. Denken wir etwa an den Frost in Brasilien, der letztes Jahr die Preise für Zucker- und Kaffee-Futures in die Höhe trieb, an Dürren, die die Ernte der Landwirte zunichtemachen, oder an einen unerwartet strengen Winter, der zu einer erhöhten Nachfrage nach Heizöl führt.
Die mitunter erhebliche Volatilität von Lebensmitteln und Energieprodukten ist auch der Grund, warum Ökonomen gerne zwischen der so genannten «Gesamtinflation» und der «Kerninflation» unterscheiden.* Erstere enthält auch Ausgaben für volatile Posten wie Lebensmittel und Energie. Die Kerninflation hingegen klammert diese Komponenten aus und wird als Indikator für die zugrunde liegende, langfristige Inflation betrachtet.
Schliesslich beeinflussen die Inflation auch saisonale Faktoren, etwa die Weihnachtszeit, oder ausserordentliche Ereignisse wie Unfälle während des Produktions- oder Transportprozesses.
* Die Länder haben hier unterschiedliche Ansätze. Während einige Länder nur zwischen Gesamtinflation und Kerninflation unterscheiden, verfolgen andere einen noch detaillierteren Ansatz. Japan zum Beispiel unterscheidet zwischen Gesamtinflation, «core»-Kerninflation (ohne frische Lebensmittel, aber einschliesslich Energie) und «core core»-Kerninflation (ohne frische Lebensmittel und ohne Energie). ↑
Nach unserer Definition dauern mittelfristige Faktoren in der Regel ein bis zwei Jahre. Mittelfristige Faktoren sind nicht unbedingt strukturell, aber haben das Potenzial, struktureller Natur zu werden.
Ein wichtiger mittelfristiger Faktor ist eine expansive Geldpolitik. Wenn «mehr Geld für die gleiche Anzahl von Waren ausgegeben wird», wenn also die Geldmenge in einer Volkswirtschaft schneller wächst als die Fähigkeit der Wirtschaft, Waren und Dienstleistungen zu produzieren, dann kann man steigende Preise erwarten.*
«Die These, dass eine höhere Geldmenge zu Inflation führt, ist sicherlich eine der ältesten und beständigsten in der Ökonomie.»
Higher money supply = rising prices?
Grössere Geldmenge = steigende Preise?
Es gibt mehrere Fälle, in denen sich diese These bewahrheitet hat:
- Ein Beispiel ist der amerikanische Bürgerkrieg (1861–1865). Damals waren die Konföderierten nicht gewillt, den Krieg über höhere Steuern zu finanzieren. Sie befürchteten, dass dies die öffentliche Unterstützung für ihre Sache untergraben würde. Also versuchten sie, den Grossteil ihrer Ausgaben durch das «Drucken» von Geld zu decken. Die Ausgabe grosser Mengen von US-Treasuries trieb die Preise in der Konföderation schliesslich um mehr als 9,000 Prozent in die Höhe – gegenüber «nur» 80 Prozent im Norden.
Einige argumentieren jedoch, dass diese These nicht immer zutrifft:
- So haben die Zentralbanken die Märkte nach der globalen Finanzkrise mit reichlich geldpolitischem Stimulus versorgt und dies mehr als ein Jahrzehnt lang fortgesetzt, ohne dass es nennenswerte Auswirkungen auf die Verbraucherpreise hatte.
- Ein noch interessanterer Fall ist in Japan zu beobachten. Dort verharrt die Inflation trotz jahrzehntelanger ultralockerer Geldpolitik auf tiefem Niveau.
Unsere Schlussfolgerung ist, dass wir ein erhöhtes Geldmengenwachstum als notwendigen Faktor für mehr Inflation ansehen, aber auch als einen, der nicht zwingend zu mehr Inflation führt.
«Wer mit höheren Preisen rechnet, hat einen Anreiz, jetzt und nicht später zu investieren.»
Ein weiterer mittelfristiger Faktor ist ironischerweise die Inflation selbst – beziehungsweise die Erwartung derselben. Inflationserwartungen spiegeln wider, wie stark die Preise in den Augen der Verbraucher, Unternehmen oder Investoren künftig steigen werden. Die Überlegung dahinter: Wer mit höheren Preisen rechnet, hat einen Anreiz, jetzt und nicht später zu investieren.
Dies kann wiederum die Inflation in die Höhe treiben.
* Wie wird die Geldmenge gemessen? Es gibt verschiedene Messgrössen, von denen die bekanntesten mit M0, M1, M2 und M3 abgekürzt werden. M0 bezieht sich auf den gesamten physischen Geldumlauf, M1 umfasst M0 und fügt auch Sichteinlagen, täglich fällige Einlagen und Girokonten hinzu, also Geld, das sofort verfügbar ist (so genanntes «narrow money»). M2 umfasst neben M1 auch leicht konvertierbares Geld wie Spareinlagen oder Termineinlagen, die in der Regel mit einer Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten ausgestattet sind. M3 hingegen, auch als «broad money» bezeichnet, umfasst neben M2 auch grosse Termineinlagen bei Banken und marktfähige Wertpapiere mit einer Laufzeit von höchstens zwei Jahren.
Wir definieren als «langfristig» alles, was länger als zwei Jahre andauert.
Langfristige Faktoren sind eher struktureller Natur, zum Beispiel demografische Entwicklungen wie die Alterung der Bevölkerung. Ein weiteres Beispiel ist die zunehmende De-Globalisierung und langfristige Polarisierung rund um den Globus – man denke nur an die Verlagerung der Lieferketten von den Entwicklungsländern in die Industrieländer.
Auch der Klimawandel kann als langfristiger Faktor betrachtet werden: Nehmen Naturkatastrophen weiter zu, müssen inflationstreibende Produktionsschwankungen – ähnlich wie nach den Lockdowns – einkalkuliert werden.
Zudem wird davon ausgegangen, dass auch die Umstellung auf eine «grünere» Zukunft die Preise in die Höhe treibt. Finanziert werden müssen unter anderem der
Ausstieg aus Kohle und Öl oder die Isolierung von Gebäuden. Dies wird auch als «Greenflation» bezeichnet. Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang auch Lenkungsprogramme wie die Bepreisung von Kohlendioxid.
Aktuell: Inflation Schweiz im Kontext (1870–2022)
Die im April veröffentlichten Inflationszahlen für März 2022 liegen in den USA mit 8.54% deutlich über den für die Schweiz gemeldeten 2.4%. Das war aber nicht immer so, wie ein Blick auf die letzten 150 Jahre zeigt. Als Basis der nachfolgenden Grafik dient der sogenannte Konsumentenpreisindex (Consumer Price Index, CPI). Die Zahlen für die Schweiz vor 1922 beruhen auf Schätzwerten von Forschenden.
Vor dem zweiten Weltkrieg waren die Inflationsschocks höher als in den USA
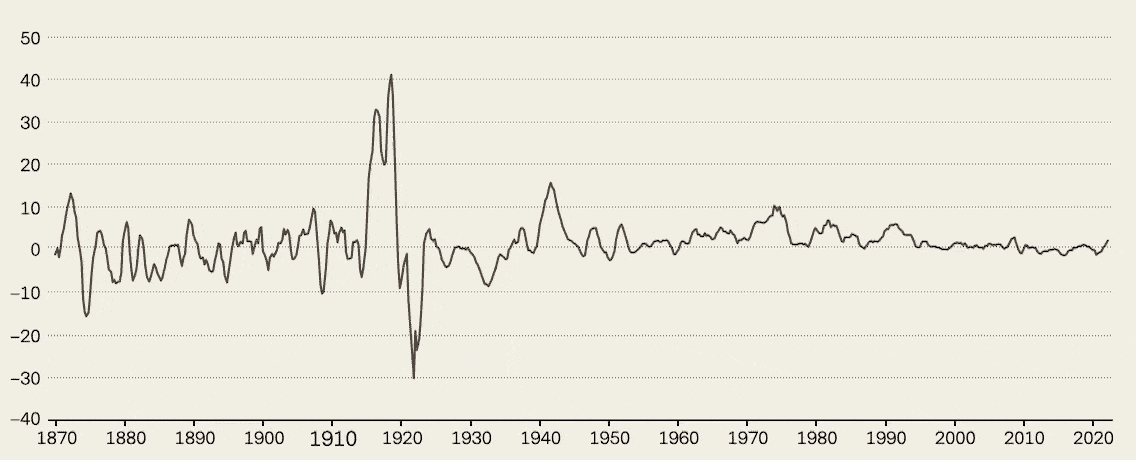
▬ Inflation in den USA 2022 und zurück bis 1870 (CPI in %)
▬ Inflation in der Schweiz 2022 und zurück bis 1870 (CPI in %)
© Vontobel 2022, basierend auf Forschungsergebnissen von Niko Hauzenberger, Daniel Kaufmann, Rebecca Stuart, Cédric Tille: «Interest rates in Switzerland 1852–2020», Fundamentals for Economic Policy No. 24, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern, Switzerland (2021), sowie Daten des Bundesamts für Statistik (BFS), Global Financial Data, Refinitiv Datastream.
Demand-pull-Inflation
Sie tritt auf, wenn in einer Volkswirtschaft die Nachfrage das Angebot übersteigt und dadurch die Preise in die Höhe treibt. Doch wie kann die Nachfrage das Angebot übersteigen?
Ein solches Szenario kann sich zum Beispiel in einer boomenden Wirtschaft entwickeln.
Wenn die Haushalte zuversichtlich sind, was die wirtschaftlichen Aussichten angeht, neigen sie dazu, mehr auszugeben, als wenn sie glauben, dass härtere Zeiten bevorstehen. Manche argumentieren auch, dass staatliche Massnahmen die Preise in die Höhe treiben können. Steuersenkungen zum Beispiel erhöhen das verfügbare Einkommen der Verbraucher. Dadurch sind sie in der Lage, mehr Geld auszugeben, was auch zu einer höheren Inflation führen sollte.
Zudem sind viele Ökonomen der Meinung, dass die Konjunkturpakete, die nach der Pandemie lanciert wurden, dazu geführt haben, dass «zu viel Geld für zu wenig Waren» ausgegeben wurde, was die Preise in die Höhe getrieben hat.
Cost-push-Inflation
Dieser Typ Inflation entsteht, wenn die Nachfrage gleichbleibt, während das Angebot an Waren oder Dienstleistungen begrenzt ist.
Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein erheblicher Mangel an Rohstoffen oder Arbeitskräften entsteht, der die Preise oder Löhne in die Höhe treibt.
Diese Art von Inflation wird häufig durch ein externes Ereignis oder einen Mangel an Investitionen ausgelöst, der später zu einem Unterangebot führen kann.
Ein solches historisches Ereignis war in den 1970er-Jahren die Entscheidung der OAPEC, der Organisation der Arabischen Erdöl exportierenden Länder, ein Erdölembargo gegen die Vereinigten Staaten zu verhängen.
- Die Kürzungen trieben den Ölpreis auf beinahe den vierfachen Preis: von 2,90 US-Dollar pro Barrel (vor dem Embargo) auf 11,65 US-Dollar pro Barrel (im Januar 1974).
- Mit der Verteuerung des Benzins verteuerte sich auch der Transport, was dazu führte, dass viele Unternehmen ihre Produktion zurückfahren mussten, da sie sich die höheren Kraftstoff- und Transportkosten nicht leisten konnten.*
* Den Grundstein für die hohe Inflation der 1970er-Jahre legten nicht die Turbulenzen auf den Ölmärkten. Schon davor belasteten der Kalte Krieg, Raumfahrtprogramme und andere Faktoren den US-Staatshaushalt.
Covid-19 machte uns zu Zeitzeugen zahlreicher Beispiele für Cost-push-Inflation. Man denke nur an die unerwartet hohen Shipping-Kosten, aufgrund derer Frachtraten etwa fünfmal so hoch sind wie im Durchschnitt der letzten zehn Jahre, oder an die temporäre Schliessung von Fabriken:
- Schliessungen in Vietnam hatten erhebliche Auswirkungen auf Bekleidungs- und Schuhhändler wie Nike oder Under Armour.
- Schliessungen von Halbleiterwerken in Malaysia wirkten sich teils erheblich auf die globale Verfügbarkeit von Computerchips aus. Denn das Land spielt eine wenig bekannte, aber wichtige Rolle in den Lieferketten. Laut Angaben der Malaysian Investment Development Authority werden etwa sieben Prozent des Welthandels für Halbleiter über das Land abgewickelt.
Ein weiteres Beispiel lieferte 2019 die Afrikanische Schweinepest in China. Mehr als eine Million Schweine mussten gekeult werden, was zu einer Schweinefleischknappheit führte. Die Preise für Schweinefleisch stiegen im November 2019 um 110 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und trieben die chinesische Inflation auf ein Achtjahreshoch.
Stagflation
Wenn alles Schlechte zusammenkommt
Bei der Stagflation treffen vier Faktoren aufeinander: steigende Preise, stagnierendes Wirtschaftswachstum, enttäuschende Unternehmensgewinne und hohe Arbeitslosigkeit.
Während sich Ökonomen über die Ursachen der Stagflation uneins sind, werden Argumente wie eine schlechte Wirtschaftspolitik und Angebotsschocks am häufigsten angeführt.
Fehlgeleitete Wirtschaftspolitik kann sich in Form von unternehmensfeindlichen Massnahmen oder hohen Steuern äussern und geht in der Regel mit einer zu schnell wachsenden Geldmenge einher. In den USA beispielsweise ebneten die wirtschaftlichen Boomjahre der späten 1950er- und 1960er-Jahre den Weg für die Stagflation der 1970er-Jahre.
Angebotsschocks hingegen können auftreten, wenn eine Volkswirtschaft eine plötzliche Zu- oder Abnahme des Angebots einer Ware oder Dienstleistung erlebt. Beispiele hierfür sind Energie-, Nahrungsmittel- oder Arbeitsangebotsschocks, wie sie in der Weimarer Republik vorkamen.
Apropos Angebotsschock: Insbesondere die derzeitige Situation hat Befürchtungen geschürt, dass wir bald in eine Stagflation eintreten könnten. Auch wenn wir ein solches Szenario nicht ausschliessen können, halten wir es derzeit nicht für wahrscheinlich.
Zwar stimmt es, dass das Wirtschaftswachstum etwas an Schwung verloren hat. Allerdings trügt der direkte Vergleich mit dem ausserordentlichen Aufschwung nach den ersten Lockdowns. Blickt man darüber hinaus, bleibt vom jetzigen Rückgang ein Wachstum, das höher ist als vor der Pandemie.
Hinzu kommt, dass in vielen Teilen der Welt die Arbeitslosenzahlen sinken und die Unternehmensgewinne weiterhin solide sind. Letzteres wurde durch die Berichtssaison für das dritte Quartal 2021 einmal mehr bestätigt: Die Zahlen zeigten, dass viele Unternehmen trotz steigenden Preisdrucks weiterhin positiv überraschen können.
Auch sind die Finanzen der privaten Haushalte nach wie vor solide – ein gutes Zeichen für zukünftigen Konsum.
Grafik: Sparquote der Haushalte (in Prozent zum Einkommen)
| ▬ USA | ▬ Schweiz | |
| ▬ UK | ▬ Japan | |
| ▬ China | ▬ Eurozone |
© Vontobel 2002. Quelle: Refinitiv Datastream, Oxford Economics, Vontobel
Die Sparquote liegt weltweit vielerorts deutlich über dem Niveau vor der Krise.
Gewinner und Verlierer in einem inflationären Umfeld
Wer hat am meisten unter steigenden Preisen zu leiden?
Zuerst einmal Sparer, da höhere Preise den realen Wert ihrer Ersparnisse verringern.
Betroffen sind auch Arbeitnehmende, die an feste Lohnverträge gebunden sind, oder Kreditgeber wie Banken, die feste Zinszahlungen für ihr Geld vereinbart haben. Nicht zu vergessen Importeure, deren gehandelte Waren in der Regel teurer werden, wenn die Landeswährung mit einer höheren (inländischen) Inflationsrate gegenüber Währungen mit geringerer Inflation an Wert verliert.
Andere profitieren von höheren Preisen
In der Regel sin dies alle, die Schulden mit einer nominell festen Zinszahlung haben, wie verschuldete Regierungen, Unternehmen und Haushalte.
Unternehmen mit einer hohen Schuldenlast profitieren in der Regel ebenfalls. Denn ein inflationäres Umfeld ermöglicht es ihnen oft, die höheren Preise an die Verbraucher weiterzugeben. Das «zusätzliche Geld», das dabei entsteht, kann dann zur Tilgung ausstehender Schulden verwendet werden.
Zudem können auch Privatpersonen, die in so genannte Inflationsabsicherungen (Sachwerte wie Immobilien, Rohstoffe oder Gold) investiert haben, profitieren, wenn der Wert ihrer Anlagen steigt.
Ebenfalls spannend in diesem Kontext
Publiziert am 25.04.2022 MESZ
ÜBER DIE AUTOREN
 Weitere Artikel anzeigen
Weitere Artikel anzeigenStefan Eppenberger
Head Investment Strategy
Stefan Eppenberger kam 2008 zu Vontobel. Seit September 2024 ist er Chief Investment Strategist innerhalb von Multi Asset und leitet das Investment Strategy Team. Er ist verantwortlich für die Festlegung der Anlagestrategie, welche in den Kunden-Portfolios zum Tragen kommt. Ausserdem ist er stimmberechtigtes Mitglied des Multi Asset Investment Committee. Zuvor hatte er verschiedene Positionen in den Bereichen Wirtschaftsanalyse, Anlagestrategie, Asset Allocation, Fonds-Research und Portfolio-Management inne.

